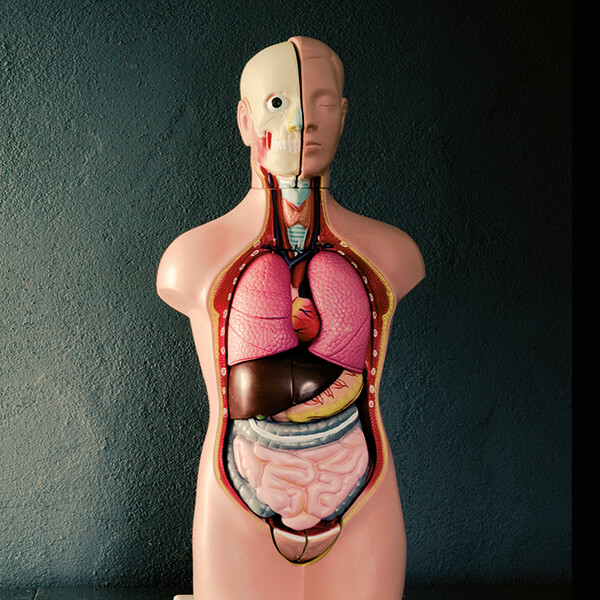Pflichtangaben gem. § 4 HWG
EMB-Fatol®
EMB-Fatol® 100 mg Tabletten,
EMB-Fatol® 250 mg / 400 mg / 500 mg, Filmtabletten,
EMB-Fatol® 1,0 g, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Wirkstoff: Ethambutoldihydrochlorid
Zusammensetzung:
(Film)-tab.: 1 (Film)-Tab. enthält 100 mg/ 250 mg/ 400 mg/ 500 mg Ethambutoldihydrochlorid.
Sonst. Bestandt.: Croscarmellose-Natrium, Calcium hydrogenphosphat-Dihydrat, Lactose-Monohydrat,
Copovidon, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Hypromellose, Macrogol 6000,
Hochdisperses Siliciumdioxid, Crospovidon, Povidon. Filmtab. zusätzl.: Titandioxid (E171).
Inf.lsg.: 1 Flasche mit 10 ml enthält 1,0 g Ethambutoldihydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Wasser für
Injektionszwecke, Natriumhydroxid.
Anwendungsgebiete:
(Film)-Tab./ Inf.lsg: Zur Behandlung aller Formen und Stadien der der pulmonalen und extrapulmonalen Tuberkulose mit Erregerempfindlichkeit gegen Ethambutol, immer in Kombination mit weiteren antimykobakteriell wirksamen Arzneimitteln. Zur empirischen Therapie in der Initialphase der Standardbehandlung der Tuberkulose bei zunächst unklaren Resistenzsituationen bzw. in Wiederbehandlungsfällen. Zum Einsatz in modifizierten Therapieregimen der Tuberkulose bei nachgewiesener Resistenz gegen einen oder mehrere Standardkombinationspartner. Inf.lsg. zusätzl.: Bei Patienten angewendet, bei denen eine orale Einnahme nicht möglich oder eine Resorptionsstörung bekannt ist. Eine möglichst schnelle Umstellung auf eine orale Therapie ist anzustreben.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Ethambutol und/oder einen der sonstigen Bestandteile. Schädigung des Sehnervs. Schwerwiegende Augenerkrankung (z.B. im Rahmen eines Diabetes, sog. diabetische Retinopathie). Augenschäden, die eine Kontrolle des Sehvermögens behindern. Bei Patienten, bei denen aus anderen Gründen eine zuverlässige Kontrolle des Sehvermögens nicht oder nicht mehr möglich ist.
Nebenwirkungen:
Augenerkrankungen: Sehr häufig: Dosisabhängige Entzündung des Sehnervs (Nervus opticus-Neuritis) mit Verlust der Rot-Grün-Unterscheidung, Visusminderung, Zentralskotom bzw. Einschränkung der Gesichtsfeldaußengrenzen, bei frühzeitigem Bemerken entsprechender Symptome sowie unverzüglichem Absetzen von EMB-Fatol® ist die Symptomatik in der Regel reversibel.Nicht bekannt: Irreversible Sehschäden (Blindheit) bei nicht rechtzeitiger Unterbrechung der Therapie. Erkrankungen des Nervensystems: Häufig:
Parästhesie (v. a. in den Extremitäten),, Kopfschmerzen, Schwindel, Fingerzittern. Psychiatrische Erkrankungen: Häufig: Verwirrtheitszustände, Desorientiertheit, Halluzinationen. Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Gelegentlich:
Nephrotoxische Effekte. Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Sehr häufig: Erhöhte Harnsäurewerte im Blut (insbesondere bei Gichtpatienten). Bei etwa 50 % der behandelten Patienten, insbesondere bei Gichtpatienten, werden erhöhte Harnsäurewerte im Blut gefunden. Es wird ein konkurrierender Mechanismus bei der Elimination der Harnsäure im Tubulusapparat angenommen. Dieser Befund kann bereits 24 Stunden nach einer einzigen Dosis oder auch erst nach 90 Tagen Therapie erstmals auftreten und wird möglicherweise durch gleichzeitige Therapie mit Isoniazid und Pyridoxin begünstigt. Im Zusammenhang mit 4-fach Kombinationstherapien (Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid und Ethambutol) sind auch Fälle von Arthralgien aufgetreten. Erkrankungen des Immunsystems: Gelegentlich: Allergische Reaktionen wie Exanthem, Juckreiz, Fieber und/oder Leukopenie. Selten: schwere akute Überempfindlichkeitsreakionen (anaphylaktischer Schock). Nicht bekannt: Pneumonitis, Neutropenie Eosinophilie, Steven-Johnson-Syndrom. Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes: Nicht bekannt: Blähungen, Völlegefühl, abdominale Beschwerden, Übelkeit. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Gelegentlich: Juckreiz, Exantheme, Lichen. Leber- und Gallenerkrankungen: Gelegentlich: Störungen der Leberfunktion (Transaminasen erhöht, H, besonders unter hohen Dosen von Ethambutol. Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Gelegentlich: Leukopenie im Rahmen allergischer Reaktionen). Selten: Blutbildveränderungen wie Thrombozytopenie. Nicht bekannt: Neutropenie mit Eosinophilie (im Rahmen allergischer Reaktionen). Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums: Nicht bekannt: Pneumonitis (im Rahmen allergischer Reaktionen).
Warnhinweise:
(Film)-Tab.: Enthält Lactose.
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland
Stand: 11/2021
EREMFAT®
EREMFAT® 150 mg/300 mg/450 mg/600 mg, Filmtabletten; EREMFAT® i.v. 300 mg/600 mg, Infusionslösung; EREMFAT® Sirup, 100 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Quantitative und qualitative Zusammensetzung: Filmtabletten: 1 Filmtablette enthält 150 mg/300 mg/450 mg/600 mg Rifampicin. Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], hochdisperses Siliciumdioxid, Sorbitol (Ph.Eur.) (E 420), Hypromellose, Macrogol (6000), Propylenglycol (E 1520), Eisen(III)-oxid (E 172), Titandioxid (E 171). Infusionslösung: 1 Durchstechflasche Eremfat i.v. 300 mg/600 mg mit 313,2 mg/626,4 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung enthält 308,2/616,4 mg Rifampicin-Natrium (entsprechend 300 mg/600 mg Rifampicin). Sonstige Bestandteile: Natriumascorbat 5 mg/10 mg (als Stabilistor). Suspension: 1 Flasche mit 28,2 g Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält 1,2 g Rifampicin. Sonstige Bestandteile: Sucrose, Carmellose-Natrium (Ph.Eur), hochdisperses Siliciumdioxid, Polysorbat 80, Schokoladenaroma, Natriumbenzoat (E 211). Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Behandlung aller Formen der Tuberkulose mit Erregerempfindlichkeit gegen Rifampicin, immer in Kombination mit weiteren gegen die Tuberkuloseerreger wirksamen Chemotherapeutika. Behandlung von pulmonalen, lokalisierten extrapulmonalen sowie disseminierten Infektionen durch nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM), immer in Kombination mit weiteren antimykobakteriell wirksamen Antibiotika. Kombinationsbehandlung der Lepra. Kombinationsbehandlung schwerwiegender grampositiver und gramnegativer nicht-mykobakterieller Infektionen mit Erregerempfindlichkeit gegenüber Rifampicin: Grampositive Infektionen: schwere Staphylokokken-Infektionen, die durch Staphylococcus aureus oder S. epidermidis verursacht sind, einschließlich Methicillin-resistenter Staphylokokken (MRSA) [Osteomyelitis, Klappenprothesenendokarditis und Fremdkörper-assoziierte Infektionen]. Gramnegative Infektionen: Kombinationsbehandlung der Brucellose. Prophylaxe der Meningokokken – Meningitis: zur Behandlung asymptomatischer Träger von Neisseria meningitidis zur Eliminierung von Meningokokken aus dem Nasopharynx. Die Chemoprophylaxe wird für folgende zwei Gruppen empfohlen: den Patienten nach der kurativen Behandlung und vor der Wiedereingliederung in die Gemeinschaft und alle Personen, die innerhalb von 10 Tagen vor dem Krankenhausaufenthalt den Oropharynxsekreten des Patienten ausgesetzt waren. Prophylaxe der Haemophilus influenzae Typ b (Hib)-Meningitis: zur Behandlung asymptomatischer Träger von H. influenzae und als Chemoprophylaxe exponierter [Infusionslösung & Suspension zusätzlich: (ungeimpfter oder unzureichend geimpfter) Kinder ab einem Alter von 1 Monat bis zum Alter von 4 Jahren und exponierter] Personen mit relevanter Immundefizienz bzw. -suppression. Zusätzl. Infusionslösung.: Die Verwendung der intravenösen Form ist insbesondere Patienten vorbehalten, die sich in kritischen Situationen befinden und an einer schweren Form der Krankheit leiden oder bei denen eine orale Anwendung unmöglich oder ungeeignet ist (Bewusstseinsstörungen od. Verdauungsstörungen, die die orale Einnahme des Produkts behindern). Die allgemein anerkannten Richtlinien zum angemessenen Gebrauch von antimikrobiellen und speziell antimykobakteriellen Wirkstoffen bei der Behandlung mykobakterieller Infektionen sind zu beachten. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, gegen andere Rifamycine oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Leberfunktionsstörungen (Child Pugh C), Verschlussikterus, akute Hepatitis, Leberzirrhose, Gallengangsobstruktion. Gleichzeitige Therapie mit den Proteaseinhibitoren Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Glecaprevir, Grazoprevir, Indinavir, Lopinavir, Paritaprevir, Ritonavir, Saquinavir, Tipranavir und Voxilaprevir; den Nichtstrukturproteins 5A- Inhibitoren Elbasvir, Ledipasvir, Ombitasvir, Pibrentasvir, Velpatasvir; dem potenziell leberschädigenden Breitspektrum-Triazol-Antimykotikum Voriconazol; den nicht-nucleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI) Doravirin, Etravirin, Nevirapin und Rilpivirin, den Integrase-Hemmern Bictegravir, Cabotegravir; dem pharmakokinetischen Booster Cobicistat; dem Polymerase-Inhibitor Dasabuvir und Sofosbuvir. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Erhöhung von Enzymaktivitäten wie SGOT (AST), SGPT (ALT), alkalischer Phosphatase, Gamma-Glutamyltranspeptidase. Häufig: Leichte Überempfindlichkeitsreaktionen (Fieber, Erythema exsudativum multiforme, Pruritus, Urtikaria) Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Meteorismus, Diarrhö. Gelegentlich: Ikterus, Hepatomegalie. Selten: Eosinophilie, Leukopenie, Granulozytopenie, Thrombozytopenie, thrombozytopenische Purpura, Hypoprothrombinämie, hämolytische Anämie, disseminierte intravasale Koagulopathie, schwere Überempfindlichkeitsreaktionen wie Atemnot, asthmaartige Anfälle, Lungenödem, andere Ödeme, bis hin zum anaphylaktischen Schock, Menstruationsstörungen, Addison-Krise bei Addison-Patienten, Sehstörungen, Visusverlust, Optikusneuritis, akute Pankreatitis, Erhöhung von Bilirubin im Serum, Myopathien, Nierenfunktionsstörungen. Sehr selten: Lupus-ähnliches Syndrom, Flu-Syndrom, schwere allergische Hautreaktionen wie toxische epidermale Nekrolyse (Lyell- Syndrom) und exfoliative Dermatitis, Verwirrtheit, Psychosen, Ataxie, Konzentrationsunfähigkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Parästhesien, antibiotikaassoziierte Kolitis (pseudomembranöse Enterokolitis), Clostridioides difficile assoziierte Diarrhö, akute Hepatitis (in schweren Fällen tödlicher Verlauf möglich), Muskelschwäche, akutes Nierenversagen. Nicht bekannt: Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS), Porphyrie, bräunlich-rote Verfärbung der Tränenflüssigkeit, Venenreizung, interstitielle Nephritis, Tubulusnekrosen, postnatale Blutungen bei der Mutter und dem Neugeborenen, leukozytoklastische Vaskulitis. Warnhinweise: Filmtablette: Enthält Sorbitol (E 420). Suspension: Enthält Sucrose, Natrium und Natriumbenzoat (E 211). Inhaber der Zulassung: Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland. Stand der Information: 11/2021. Verschreibungspflichtig.
ISOZID ®
ISOZID® 50 mg / 100 mg / 200 mg, Tabletten und ISOZID® 0,5 N; Pulver zur Herstellung einer
Infusionslösung
Wirkstoff: Isoniazid.
Zusammensetzung:
ISOZID® 50 mg / 100 mg / 200 mg, Tabletten:
1 Tablette enthält 50 mg / 100 mg / 200 mg Isoniazid. Sonst. Bestandt.: Mikrokristalline Cellulose,
Copovidon, Hypromellose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Hochdisperses
Siliciumdioxid, Talkum, Crospovidon (Typ A), Ph. Eur.).
ISOZID® 0,5 N, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung:
1 Durchstechflasche ISOZID® 0,5 N enthält 0,5 g Isoniazid.
Anwendungsgebiete: Zur Behandlung aller Formen und Stadien der Tuberkulose mit
Erregerempfindlichkeit gegen Isoniazid, immer in Kombination mit anderen gegen die
Tuberkuloseerreger wirksamen Chemotherapeutika. Zur Vorbeugung einer Infektion
(Chemoprophylaxe) mit Tuberkuloseerregern bei durch Kontakt mit einem Tuberkulosekranken
gefährdeten Patienten mit negativem Tuberkulintest (Hauttest zur Diagnostik bei
Tuberkuloseerkrankung). Zur vorbeugenden Behandlung (Chemoprävention) von Patienten mit
erstmalig festgestelltem Nachweis eines positiven Tuberkulintests, aber ohne Nachweis einer
Erkrankung an Tuberkulose.
Die üblichen und allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von
antimikrobiellen Wirkstoffen sind bei der Anwendung von Isoniazid zu berücksichtigen.
Zusätzl. Hinweis für ISOZID® 0,5 N; Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung:
ISOZID® 0,5 N wird zur Therapie der Tuberkulose bei Patienten angewendet, bei denen eine orale
Einnahme nicht möglich oder eine Resorptionsstörung bekannt ist. Es sollte auf die orale Gabe
umgestellt werden, sobald dies möglich ist.
Gegenanzeigen: Allergie gegen Isoniazid oder einen der sonstigen Bestandteile, bei
vorausgegangener durch Isoniazid verursachter Leberentzündung (Isoniazid-Hepatitis), bei schweren
Leberfunktionsstörungen wie Gelbsucht (Verschlussikterus), Leberentzündung (akute Hepatitis),
Leberzirrhose (chronische Lebererkrankung mit Leberzellschwund; Child Pugh C), bei Erkrankung von
Nerven mit Schmerzen und Missempfindungen z. B. in Armen und Beinen (Polyneuropathien), bei
Störungen der Blutgerinnung und Blutbildung.
Nebenwirkungen: Erkrankung des Blutes und des Lymphsystems: Nicht bekannt: Vermehrung
bestimmter weißer Blutkörperchen (Eosinophilie), Funktionsstörung des Knochenmarks
(Knochenmarksdepression) mit z. B. Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen
(Granulozytopenie, Agranulozytose), Blutplättchenmangel (Thrombozytopenie), verschiedene Formen
der Blutarmut (sideroachrestische, hämolytische und megaloblastäre Anämie, Pyridoxinmangel-
Anämie), Auftreten einer Gerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese)
durch Entzündungen der Blutgefäße (Vasculitiden), immunologisch bedingter Blutplättchenmangel
(Immunthrombopenien) und andere Gerinnungsstörungen, Verminderung aller Blutzellen
(Panmyelopathie, aplastische Anämie). Erkrankungen des Immunsystems: Nicht bekannt:
Hautausschlägea (Exantheme), pellagraähnliche Hautsymptome, schuppige Hauterkrankung
(exfoliative Dermatitis), schwere Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom), vermehrte
Lichtsensitivität, Fieber, Asthma, Muskel- und Gelenkschmerzen, Quincke-Ödem, anaphylaktische
Reaktionen, anaphylaktischer Schock, Schmetterlingsflechte (Lupus erythematodes). Endokrine
Erkrankungen: Nicht bekannt: Meist reversible Überfunktion von Nebennierenrinde (Cushing-
Syndrom) und Hirnanhangsdrüse (Hypophysenvorderlappen)b; ISOZID® 50 mg / 100 mg / 200 mg,
Tabletten: Sehr selten: Absinken des Blutzuckers unter Normalwerte (Hypoglykämie), ISOZID® 0,5 N;
Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung: Nicht bekannt: Absinken des Blutzuckers unter
Normalwerte (Hypoglykämie); Psychiatrische Erkrankungen: Nicht bekannt: Psychische Störungen
(Reizbarkeit, Ängstlichkeit), Konzentrationsschwäche, Depression, Psychosen (maniform, kataton oder
paranoid). Erkrankungen des Nervensystems: Häufig: Erkrankungen der Nervenendigungen
(periphere Polyneuropathie mit Missempfindungen), Sensibilitätsstörungen, Kopfschmerzen,
Schwindel, Nicht bekannt: Krampfanfälle, Schläfrigkeit, Lethargie. Augenerkrankungen: Nicht
bekannt: Entzündungen des Sehnervs (Optikusneuritis), Doppeltsehen (Diplopie), Schielen
(Strabismus). Herzerkrankungen: Nicht bekannt: Herzrhythmusstörungen, Blutdruckschwankungen
mit Schwindel. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Nicht bekannt:
akutes Lungenversagen (Acute respiratory distress syndrome, ARDS). Erkrankungen des
Gastrointestinaltrakts: Häufig: Gastrointestinale Störungen (Durchfall, Verstopfung, Aufstoßen,
Völlegefühl, Erbrechen), Nicht bekannt: Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis). Leber- und
Gallenerkrankungen: Sehr häufig: Erhöhung von Leberenzymen (Anstieg der Transaminasenaktivität);
Gelegentlich: Leberentzündung (Hepatits); Nicht bekannt: Akute Leberentzündung (Hepatitis; in
schweren Fällen tödlicher Verlauf möglich). Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen: Häufig: Rheumatische Beschwerden (Gelenke und Muskulatur), Auflösung
der quergestreiften Muskulatur (Rhabdomyolyse). Erkrankungen der Niere: Nicht bekannt:
Nierenentzündung (Glomerulonephritis)c. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:
Selten: Schwere großflächige Hautschäden (Toxische epidermale Nekrolyse), Arzneimittelreaktion mit
Ausschlag, Fieber, Entzündungen innerer Organe, Blutbildveränderungen und systemischen Symptome
(DRESS-Syndrom). Gefäßerkrankungen: Nicht bekannt: Entzündung der Blutgefäße (Vaskulitis).
(a u. a. akneiform besonders bei jüngeren Patienten, b mit Menstruationsstörungen bei der Frau bzw.
Hormonstörungen (gonadotrope Störungen) / Vergrößerung der Brustdrüsen (Gynäkomastie) beim Mann, c meist
reversibel)
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
RIEMSER Pharma GmbH, An der Wiek 7, 17493 Greifswald-Insel Riems, Deutschland.
Stand der Information:
ISOZID® 50 mg / 100 mg / 200 mg, Tabletten: 11/2018
ISOZID® 0,5 N; Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung: 07/2021
ISOZID ® comp.
ISOZID® comp. 100 mg, Tabletten
ISOZID® comp. 200 mg / 300 mg, Filmtabletten
Zusammensetzung:
1 (Film)-Tab. enthält 100 mg/ 200 mg/ 300 mg Isoniazid und 20 mg/ 40 mg/ 60 mg Pyridoxinhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Mikrokristalline Cellulose, Macrogol 6000, Copovidon, Crospovidon (Typ A, Ph. Eur.), Talkum, Calciumhydrogenphosphatdihydrat, Hypromellose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich]. Filmtab zusätzl.: Titandioxid (E171).
Anwendungsgebiete:
Zur Behandlung aller Formen und Stadien der Tuberkulose mit Erregerempfindlichkeit gegen Isoniazid, immer in Kombination mit anderen antimykobakteriell wirksamen Chemotherapeutika.. Zur Chemoprophylaxe einer Infektion mit Tuberkuloseerregern bei nichtinfizierten, tuberkulinnegativen Exponierten. Zur Chemoprävention einer Erkrankung an Tuberkulose bei gefährdeten Patienten mit festgestellter Tuberkulinkonversion oder bei Tuberkulinpositivität ohne klinische oder sonstige tuberkulose-spezifische Befunde. Die fixe Kombination von Isoniazid und Pyridoxin (Vitamin B6), wie sie in ISOZID® comp. vorliegt, ist vorzugsweise angezeigt bei Patienten, bei denen ein Vitamin B6-Mangel vorliegt oder zu erwarten ist oder bei denen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Isoniazid-bedingten Neuropathie besteht.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Vorausgegangene medikamenteninduzierte Hepatitis durch Isoniazid. Schwere Leberfunktionsstörungen wie Verschlussikterus, akute Hepatitis, Leberzirrhose (Child Pugh C). Polyneuropathien. Störungen der Hämostase und Hämatopoese. Während der Therapie muss auf den Genuss von Alkohol verzichtet werden.
Nebenwirkungen:
Isoniazid: Isoniazid-bedingte Nebenwirkungen treten überwiegend alters- und dosisabhängig auf und finden sich häufiger bei „Langsamacetylierern“. Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Nicht bekannt: Eosinophilie, Knochenmarksdepression mit z. B. Granulozytopenie, Thrombozytopenie, Agranulozytose, sideroachrestische, hämolytische und megaloblastäre Anämie, Pyridoxinmangelanämie, Auftreten einer hämorrhagischen Diathese durch Vasculitiden, Immunthrombopenien und humorale Gerinnungsstörungen, Panmyelopathie (aplastische Anämie). Erkrankungen des Immunsystems: Nicht bekannt: Exantheme, pellagraähnliche Hautsymptome, exfoliative Dermatitis, Stevens-Johnson-Syndrom, Photosensitivität, Fieber, Asthma, Myalgien und Arthralgien, Quincke-Ödem, anaphylaktische Reaktionen, anaphylaktischer Schock, Lupus erythematodes. Endokrine Erkrankungen: Sehr selten: Hypoglykämie. Nicht bekannt: Meist reversible Überfunktion von Nebennierenrinde (Cushing-Syndrom) und Hypophysenvorderlappen (mit Menstruationsstörungen bei der Frau bzw. gonadotropen Störungen/Gynäkomastie beim Mann). Psychiatrische Erkrankungen: Nicht bekannt: Psychische Störungen (Reizbarkeit, Ängstlichkeit), Konzentrationsschwäche, Depression, Psychosen (maniform, kataton oder paranoid). Erkrankungen des Nervensystems: Häufig: Periphere Polyneuropathie mit Parästhesien, Sensibilitätsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel. Nicht bekannt: Krampfanfälle, Schläfrigkeit, Lethargie. Augenerkrankungen: Nicht bekannt: Optikusneuritis, Diplopie, Strabismus. Herzerkrankungen: Nicht bekannt: Herzrhythmusstörungen, Blutdruck-Dysregulation mit Schwindel. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Nicht bekannt: Acute respiratory distress syndrome (ARDS). Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Häufig: Gastrointestinale Störungen (Diarrhoe, Obstipation, Aufstoßen, Völlegefühl, Erbrechen). Nicht bekannt: Pankreatitis. Leber- und Gallenerkrankungen: Sehr häufig: Anstieg der Transaminasenaktivität. Gelegentlich: Hepatitis. Nicht bekannt: Akute Hepatitis (in schweren Fällen tödlicher Verlauf möglich). Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen: Häufig: Muskelzittern. Nicht bekannt: Rheumatoide Symptome (Gelenke und Muskulatur), Rhabdomyolyse. Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Nicht bekannt: Glomerulonephritis (meist reversibel). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Selten: Toxische epidermale Nekrolyse, Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen. Gefäßerkrankungen: Nicht bekannt: Vaskulitis. Pyridoxin (Vitamin B6): ist allgemein gut verträglich, jedoch können bei chronischer Einnahme hoher Dosen periphere Neuropathien und Kopfschmerzen auftreten.
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland
Stand der Information: 11/2021
PETEHA ®
PETEHA®, 250 mg, Filmtabletten
Wirkstoff: Protionamid.
Zusammensetzung:
1 Filmtab. enthält 250 mg Protionamid. Sonst. Bestandt.: Croscarmellose-Natrium, Copovidon (Typ A,
Ph.Eur.), Crospovidon, Magnesiumstearat (Ph.Eur) [pflanzlich], Hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol
6000, Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Titandioxid (E171), Gelborange S (E110), Lactose-
Monohydrat.
Anwendungsgebiete:
Zur Behandlung aller Formen und Stadien der pulmonalen und extrapulmonalen Tuberkulose als
Zweitrangmedikament bei nachgewiesener Mehrfachresistenz der Erreger gegen
Erstrangmedikamente. Zur Behandlung von Erkrankungen, die durch sogenannte ubiquitäre
Mykobakterien verursacht sind. Zur Behandlung von Lepra im Rahmen modifizierter Therapieregime.
PETEHA® wird immer in Kombination mit weiteren gegen den Erreger wirksamen Arzneimitteln und nur
bei nachgewiesener Erregerempfindlichkeit gegen Protionamid eingesetzt.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Protionamid, Gelborange S (E 110) oder einen der sonstigen Bestandteile.
Schwere Hepathopathien und akuter Hepatitis. Cerebrale Anfallsleiden oder Psychosen. Während der
Schwangerschaft und in der Stillzeit.
Nebenwirkungen:
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Anämie, Methämoglobinämie,
Hypoprothrombinämie, Hypofibrinogenämie. Erkrankungen des Immunsystems: Einzelfälle: Allergische
Reaktionen.Endokrine Erkrankungen: Selten: Gynäkomastie, Dysmenorrhö, Amenorrhö, Hypothyreose.
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Selten: Blutzuckerschwankungen und ein Absinken des
Blutzuckerspiegels bei Diabetikern. Psychiatrische Erkrankungen: Gelegentlich:
Konzentrationsstörungen, Verwirrungszustände, psychiatrische Störungen wie Depression,
Erregungszustände, Psychosen. Einzelfälle: Suizidversuche. Erkrankungen des Nervensystems:
Häufig: Schwindel, Kopfschmerzen. Selten: Krampfanfälle, Schlafstörungen. Eine Schädigung des Nervus
opticus mit Schleiersehen, Augenmuskellähmungen und Akkomodationsstörungen ist berichtet worden.
Ein Schulter-Hand-Syndrom im Sinne einer Algodystrophie ist ebenfalls berichtet worden. Besonders bei
gleichzeitiger Gabe von Isoniazid: Sehstörungen, entzündliche Polyneuropathien mit Parästhesien,
Muskelschwäche, Ataxie. Augenerkrankungen: Sehstörungen u. a. Diplopie. Erkrankungen des Ohrs
und des Gleichgewichtsorgans: Einzelfälle: Nachlassen des Gehörs, Tinnitus. Erkrankungen der
Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Einzelfälle: Hämoptoe. Erkrankungen des
Gastrointestinaltraktes: Sehr häufig: Metallischer oder schwefliger Geschmack, Mundtrockenheit, aber
auch vermehrter Speichelfluss, Appetitlosigkeit, Anorexie, Übelkeit. Gelegentlich: Erbrechen, Sodbrennen,
Bauchschmerzen, Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfung, Meteorismus. Diese Nebenwirkungen
verschwinden rasch und vollständig nach Absetzen von PETEHA®. Eine einschleichende Dosierung kann
die Verträglichkeit möglicherweise steigern. Auch eine Dosisreduktion und/oder die Kombination mit einem
Antiemetikum haben sich als hilfreich erwiesen. Über eine Schwellung der Parotis wurde berichtet. Leberund
Gallenerkrankungen: Häufig: Anstieg der Transaminasen, nach Absetzen reversibel. Selten:
ausgeprägte Leberfunktionsstörung mit Ikterus. Die leberschädigende Wirkung hängt dabei entscheidend
von der Vorschädigung der Leberfunktion (z. B. Alkoholkrankheit, posthepatische Leberfunktionsstörung)
ab und findet sich gehäuft bei Kombination mit anderen potentiell leberschädigend wirkenden Arzneimitteln
(Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid). Schwere Leberentzündungen mit Gelbsucht. Einzelfall:
Leberversagen. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Pellagra-ähnliche
Reaktionen, Photodermatosen, Rhagaden, Stomatitis, Akne, Cheilitis, Glossitis, Alopezie.
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen: Arthralgien, Arthritis,
Muskelschwäche. Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Urolithiasis.
Warnhinweise:
Enthält Gelborange S (E 110) und Lactose. Packungsbeilage beachten.
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland
Stand: 11/2021
PYRAFAT ®
PYRAFAT® 500 mg, Filmtabletten
Wirkstoff: Pyrazinamid.
Zusammensetzung:
1 Filmtablette enthält 500 mg Pyrazinamid. Sonst. Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Copovidon, Croscarmellose Natrium, Crospovidon (Typ A, Ph. Eur.), Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur. ) [pflanzlich], hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 6000, Titandioxid (E 171).
Anwendungsgebiete:
Behandlung aller Arten von Tuberkulose, verursacht durch Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum und Mycobacterium microti. PYRAFAT® 500 mg ist stets in Kombination mit anderen antituberkulös-wirksamen Medikamenten einzunehmen.
Gegenanzeigen:
Vorhandene schwere Leberfunktionsstörungen (Child Pugh C), akute Lebererkrankungen (z. B. Hepatitis) sowie bis zu 6 Monate nach überstandener Leberentzündung. Porphyrie (Störung der Bildung des roten Blutfarbstoffs). Allergie gegen Pyrazinamid oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels.
Nebenwirkungen:
Häufig: Anstieg des Harnsäurespiegels (Hyperurikämie), Appetitlosigkeit, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen, Sodbrennen, Krämpfe im Unterbauch, Gewichtsabnahme, Anstieg der Leberenzymwerte (Serumtransam inasen), Leberfunktionsstörungen, Gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Photosensibilisierung)
Selten: Überem pfindlichkeitsreaktionen, Kopfschmerzen, Schwindel, Erregbarkeit, Schlaflosigkeit, Schwere Leberschädigungen (Hepatotoxizität), Rötung der Haut (Histamin-bedingter Flush), Gelenkschmerzen (Arthralgie)
Sehr selten: Störungen des blutbildenden Systems, besondere Form der Blutarmut (sideroblastische Anämie), Blutplättchenmangel (Thrombozytopenie), Beeinträchtigung der Nebennierenrindenfunktion (17-Ketosteroid-Ausscheidung im Harn), Gichtanfälle, Porphyrie, Pellagra, Bluthochdruck (Hypertonie), Hautausschläge (Erythema multiforme), Nierengewebsentzündung (Tubulointerstitielle Nephritis)
Warnhinweise:
Enthält Lactose.
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland
Stand: 11/2021
TERIZIDON
TERIZIDON, 250 mg, Hartkapseln
Wirkstoff: Terizidon
Zusammensetzung:
1 Hartkapsel enthält 250 mg Terizidon. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Gelatine, Talkum,
gereinigtes Wasser, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Copovidon, Titandioxid (E171),
Eisen(III)–hydroxid-oxid x H2O (E 172), Indigocarmin (E132).
Anwendungsgebiete:
Im Rahmen einer antituberkulösen Kombinationstherapie zur Behandlung der Tuberkulose bei
Erwachsenen, hervorgerufen durch Mycobacterium tuberculosis bei Erwachsenen. Anwendung nur,
wenn infolge von nachgewiesenen Resistenzen oder Unverträglichkeiten nicht genügend andere
Kombinationspartner zur Verfügung stehen.
Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Terizidon und/oder Cycloserin oder einen der sonstigen Bestandteile.
Schwere Niereninsuffizienz (Serumkreatinin > 2 mg/dl). Hochgradige Zerebralsklerose. Alkoholismus.
Psychische Störungen (z. B. Depression, schwere Angstzustände, Psychosen). Epilepsie. Infektionen
mit Mycobacterium bovis BCG.
Nebenwirkungen:
Erkrankungen des Nervensystems: Häufig: Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Erregbarkeit, Zittern,
Schlaflosigkeit, Trunkenheitsgefühl. Selten bis gelegentlich: epileptoide Krampfanfälle und psychische
Reaktionen depressiven und manischen Typs, Angstgefühle. Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes: Selten bis gelegentlich: Übelkeit, Bauchschmerzen, Meteorismus, Verdauungsstörungen,
Durchfäll, Obstipation. Bei Anwendung von Cycloserin (aus dem Wirkstoff Terizidon wird Cycloserin
freigesetzt): Kongestive Herzinsuffizienz, Stevens-Johnson-Syndrom, Hautausschlag, megaloblastäre
Anämie, Lebertoxizität, Überempfindlichkeitsreaktionen, Erkrankungen des Zentralnervensystems
(Benommenheit, Schläfrigkeit, Koma, Kopfschmerzen, Zittern, Dysarthrie, Schwindel, Verwirrtheit,
Desorientierung mit Erinnerungsverlust, Nervosität, Erregbarkeit, Psychosen [unter Umständen mit
Suizidalität], Paranoia, Katatonie, Zuckungen, Hyperreflexie, Sehstörungen, Parese, epileptoide
Anfälle, epileptiforme Absenz, Enzephalopathie). Es ist zu erwarten, dass diese Nebenwirkungen auch
bei Anwendung von Terizidon auftreten.
Warnhinweise:
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
Verschreibungspflichtig.
Pharmazeutischer Unternehmer:
Esteve Pharmaceuticals GmbH, Hohenzollerndamm 150-151, 14199 Berlin, Deutschland.
Stand: 11/2021